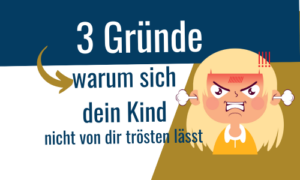
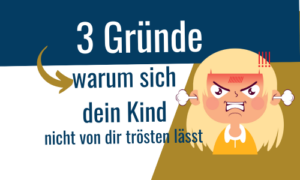
3 Gründe, warum sich dein Kind nicht von dir trösten lässt
“Unsere Wutanfälle werden immer schlimmer” Folgende Nachricht erreichte mich in der Kita-Sprechstunde: Hallo Franziska, ich habe das Gefühl, dass die Wutanfälle meines Sohnes in letzter Zeit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
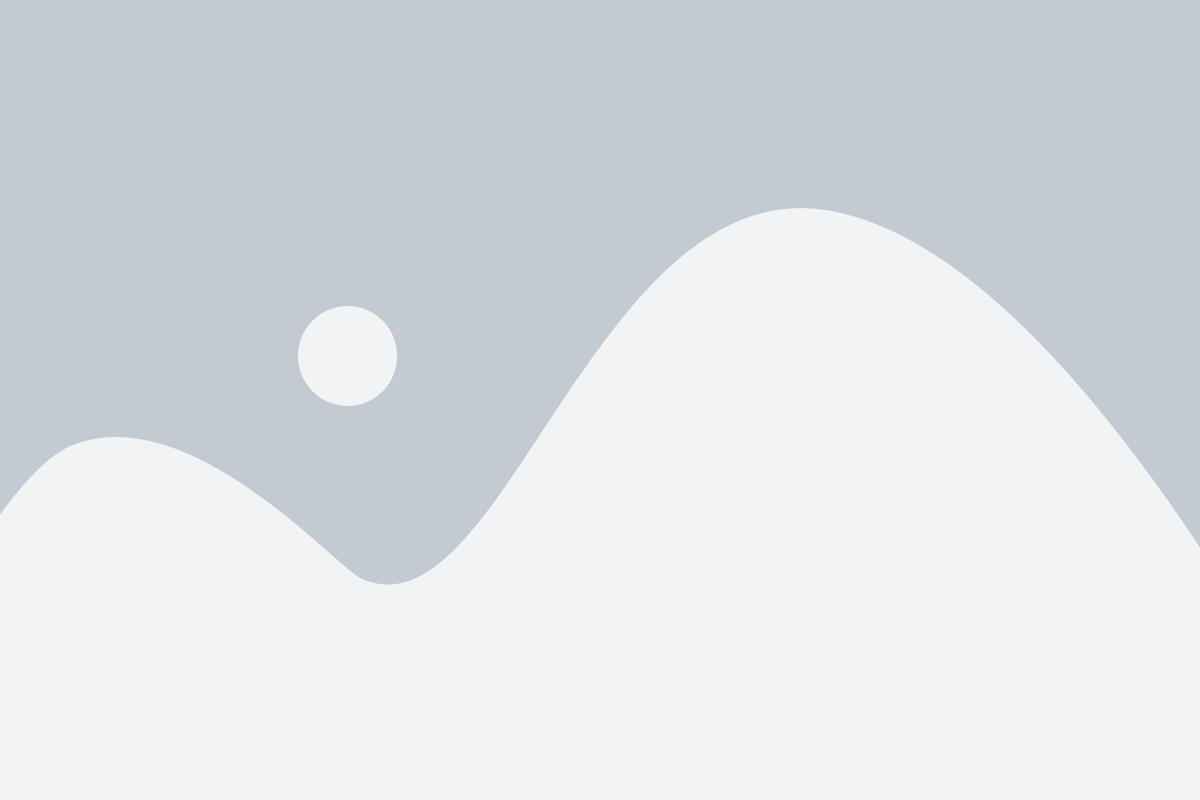
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
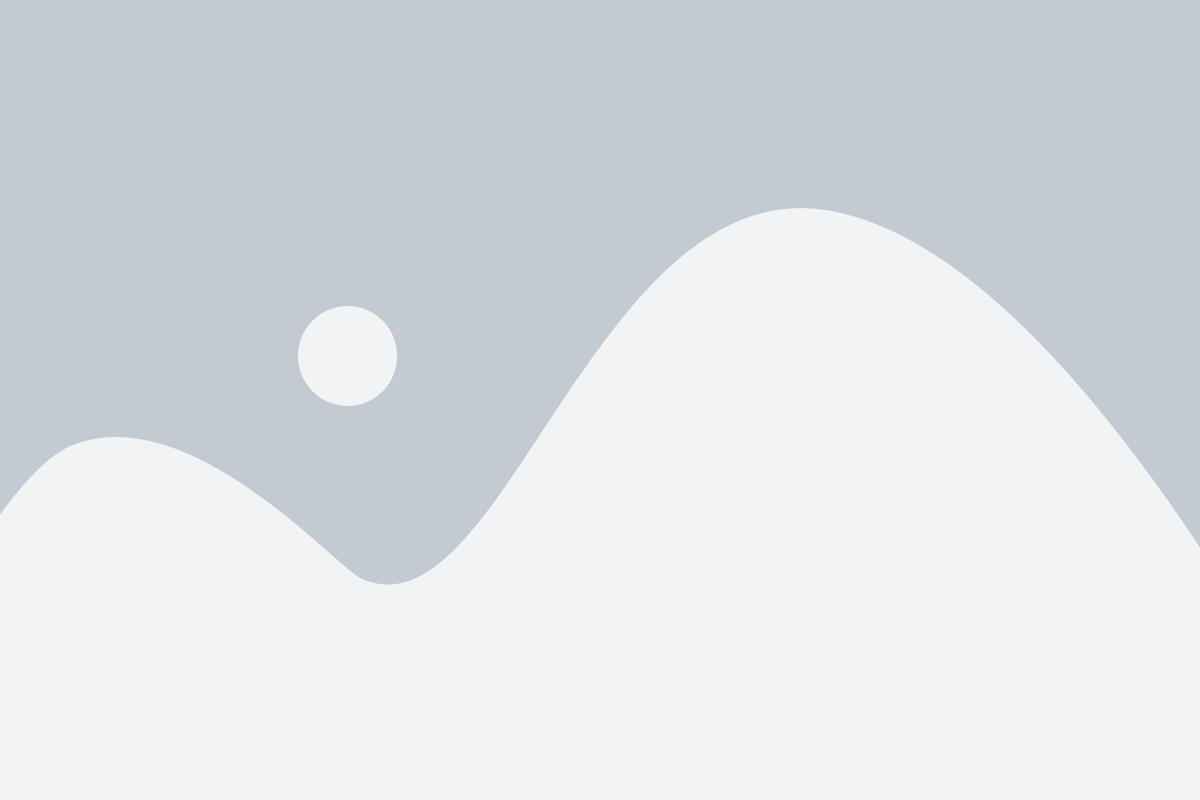
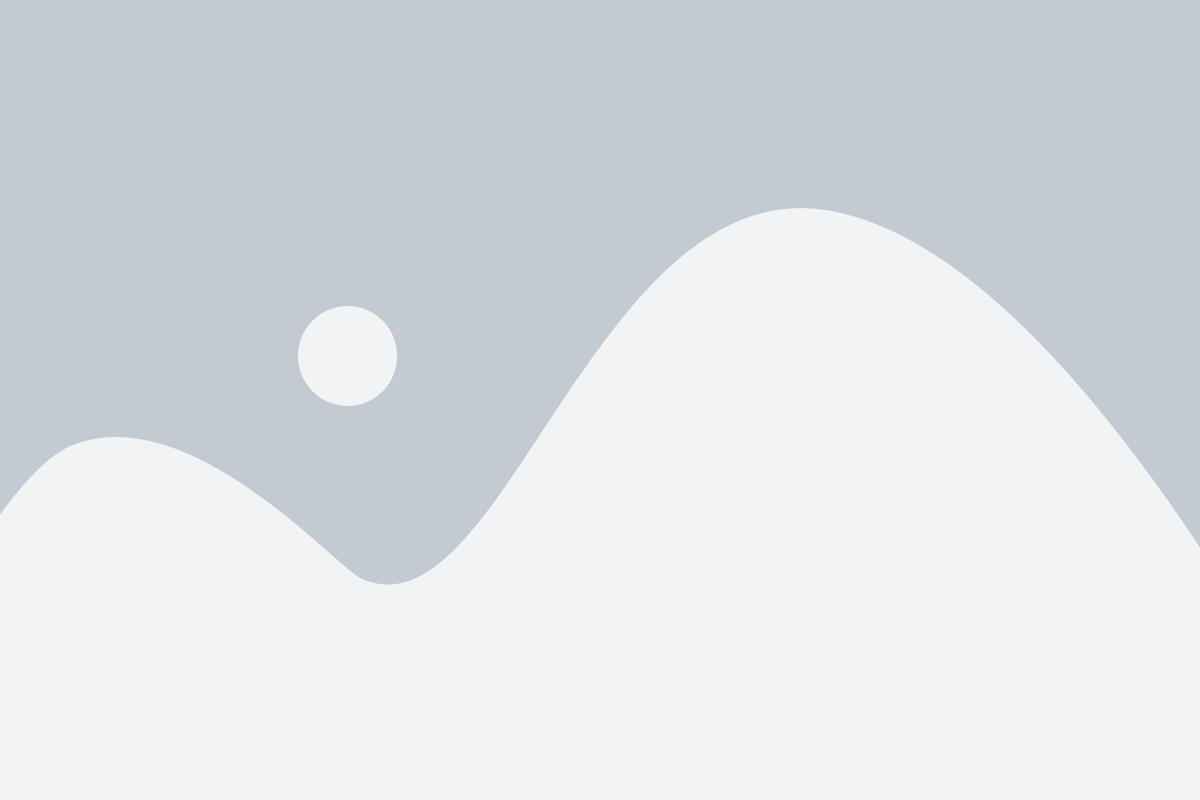
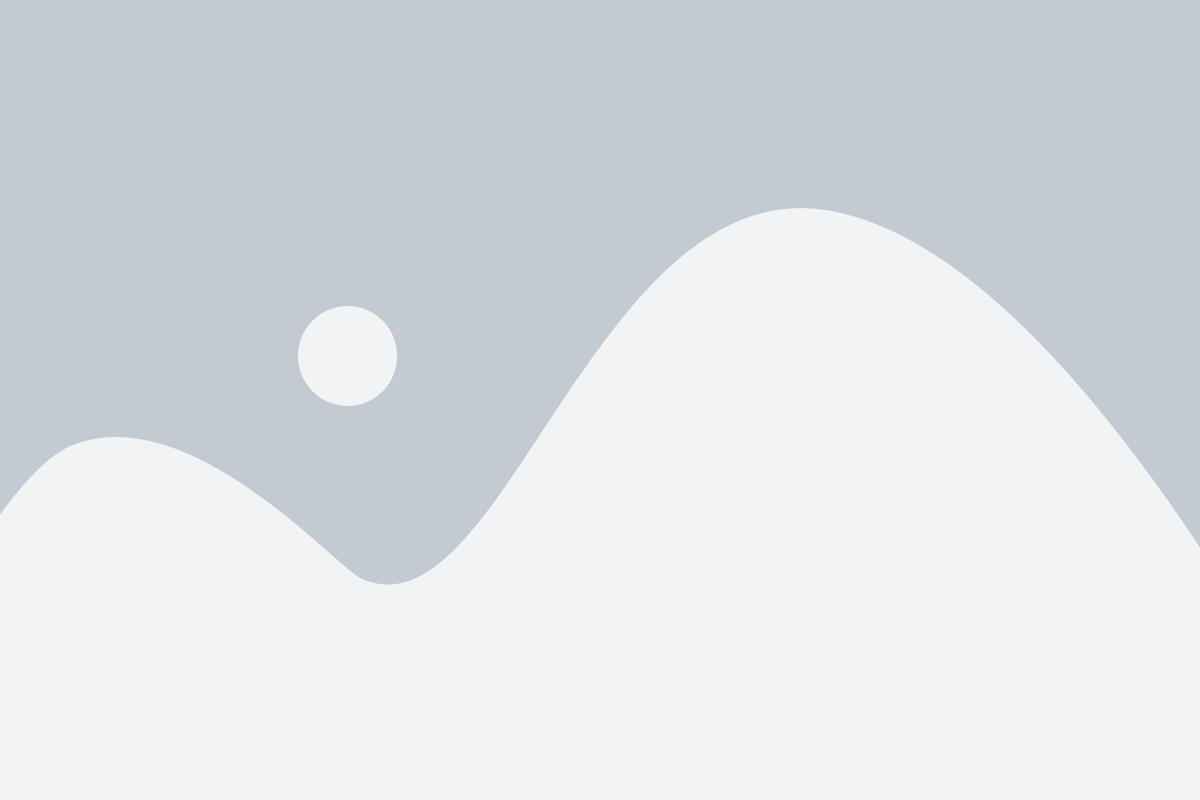
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
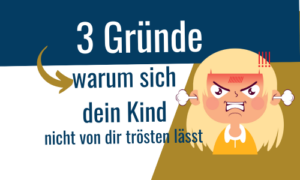
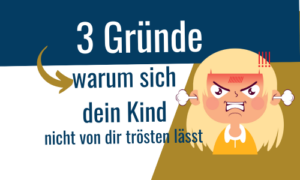
“Unsere Wutanfälle werden immer schlimmer” Folgende Nachricht erreichte mich in der Kita-Sprechstunde: Hallo Franziska, ich habe das Gefühl, dass die Wutanfälle meines Sohnes in letzter Zeit


Mein Kind schreit und haut und lässt sich nicht trösten “Hallo Franziska, ich brauche mal deine Meinung zum Verhalten meiner Tochter. Sie hat starke Wutanfälle
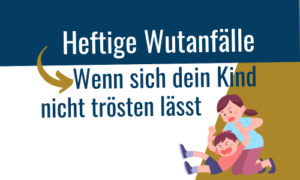
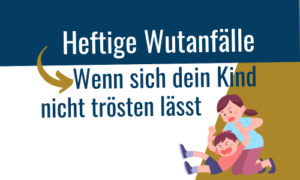
Tu das, wenn dein Kind sich nicht trösten lässt… Kleine Kinder haben häufig Wutanfälle. Das ist zunächst erstmal nicht ungewöhnlich, weil Kinder eben erstmal lernen
